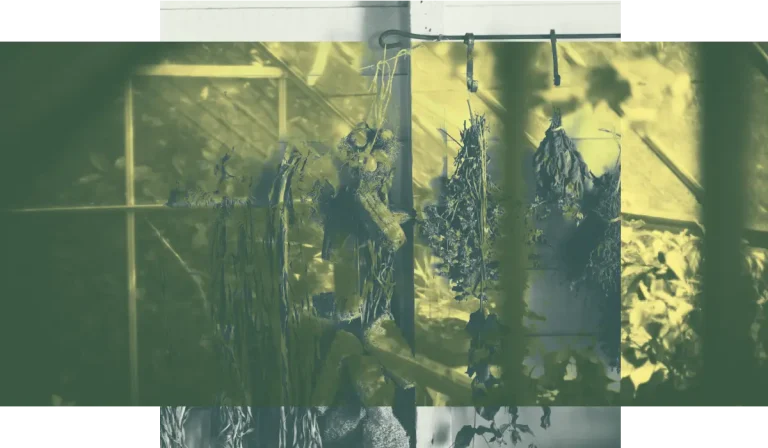Für die Böden, unser Klima, das Grundwasser und die Artenvielfalt wäre das auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung. Doch reicht das – und tut die Politik genug, um überhaupt erst mal dieses Ziel zu erreichen? Berlin, Ende Januar, grauer Himmel: Zum zwölften Mal hat das Bündnis »Wir haben es satt!« zur Demonstration in die Hauptstadt eingeladen — und Tausende sind gekommen. Landwirtinnen laufen neben Umweltaktivisten, Biofachverkäuferinnen neben Gärtnern und Bäckern, Gewerkschafterinnen sind ebenso dabei wie »ganz normale Menschen«. Sie alle wollen bessere Bedingungen für die Bio-Branche, mehr Tierwohl, mehr Klimaschutz, weniger Pestizide, dass Bio bezahlbar ist und generell: mehr Öko auf dem Acker. Schon vor Beginn der Demo waren einige von ihnen bei Cem Özdemir, um ihm ein Protestschreiben zu überreichen. »Umweltleistungen der Bauern entlohnen«, verlangen sie auf einem ihrer Transparente. »Existenzgründungen fördern! Junge Bäuer:innen braucht das Land«, auf einem anderen. Forderungen, die der grüne Landwirtschaftsminister eigentlich unterstützen dürfte — unterstützen muss, wenn er es mit seinen eigenen Zielen ernst meint.
Nicht unmöglich, aber in weiter Ferne
Bis zum Jahr 2030 sollen 30 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland ökologisch bewirtschaftet werden. Aber noch liegt dieses Ziel in weiter Ferne: Laut Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), dem Bio-Spitzenverband in Deutschland, betrug der Öko-Anteil an der landwirtschaftlichen Fläche vergangenes Jahr gerade mal 11,2 Prozent. Auch das Wachstum von gerade einmal 0,4 Prozentpunkten mehr als im Jahr davor, ist zögerlich. In diesem Schneckentempo wird die Bundesregierung ihr Ziel deutlich verfehlen. »Es ist nicht unmöglich, die 30 Prozent Bio-Fläche bis 2030 zu erreichen, aber die Anstrengungen müssen auf allen Ebenen verstärkt werden«, sagt Gerold Rahmann, der das Thünen-Institut für ökologischen Landbau leitet und die Bundesregierung berät. Und zwar vor allem von Seiten der Politik, ergänzt Peter Röhrig, geschäftsführender Vorstand beim BÖLW: »Es gibt genügend Verbraucher und Bäcker und Metzger und Bauern, die das anpacken wollen. Aber die Politik muss mehr in Angriff nehmen, als sie das im Moment tut.«
Bio-Landbau spart Kosten in Milliardenhöhe
Zum Beispiel: dafür sorgen, dass sich die wahren Kosten eines Produktes auch an der Ladentheke wiederfinden. Derzeit verursacht die (konventionelle) Landwirtschaft in Deutschland jedes Jahr einen Schaden in Höhe von 90 Milliarden Euro: Sie belastet das Grundwasser, verteilt Pestizide in der Umwelt, bedroht die Artenvielfalt, lässt ganze Ökosysteme leiden und sie heizt unseren Planeten auf. Laut einer Studie der Technischen Universität München spart der Ökolandbau schon heute jährlich 1,5 Milliarden Euro an Umweltschäden ein: Weil keine Pestizide und mineralischen Dünger eingesetzt werden, setzt er pro Hektar nur halb so viele Treibhausgase frei wie die konventionelle Landwirtschaft. Mit dem Erreichen des 30-Prozent-Ziels würden im Jahr sogar vier Milliarden Euro eingespart.
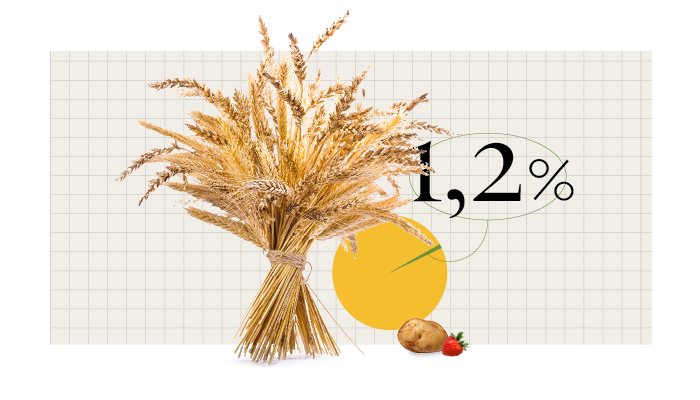
Produkte zeigen nicht den wahren Preis
Wer vor diesem Hintergrund Bio kauft, tut auf jeden Fall das Richtige – und müsse belohnt werden, findet Peter Röhrig. Der BÖLW fordert, dass zum einen Verbraucher:innen für Bio-Produkte weniger Steuern zahlen müssen. Zum anderen sollten die Unternehmen, die Pestizide und mineralische Dünger herstellen, eine Abgabe zahlen — damit sich die realen Kosten, die ein Produkt verursacht, auch an der Kasse zeigen. »Solange es diese Kostenwahrheit am Markt nicht gibt, muss der Ökolandbau stärker gefördert werden«, ist der Agrarwissenschaftler überzeugt. Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), mit der die Europäische Union festlegt, an welche landwirtschaftlichen Betriebe wie viele Fördermittel fließen, sei derzeit nicht nur »zu bürokratisch und zu wenig umweltwirksam«. Sie grenze Bio-Betriebe sogar systematisch aus. Denn obwohl gerade diese viele der Förderkriterien erfüllen, können sie aus bürokratischen Gründen oft keine Gelder dafür beantragen — zum Beispiel, weil sie schon aus anderen Töpfen gefördert werden und eine Doppelförderung nicht zulässig ist.
Reform der GAP gefordert
Das 30-Prozent-Ziel lässt sich so jedenfalls nicht erreichen: Der BÖLW schätzt, dass sich mit der aktuellen GAP bis zum Ende der laufenden Periode im Jahr 2027 nur ein Bio-Anteil von 14 Prozent erreichen lässt. Dass sich der Bio-Anteil in den drei Jahren danach verdoppelt, scheint unrealistisch. Röhrig und sein Team haben daher eine Reform der GAP vorgeschlagen. Am meisten Geld gäbe es demnach für diejenigen, die mindestens nach der EU-Öko-Verordnung wirtschaften. Beispiel Ackerbau: In der Stufe »Basis« dürfen laut Vorschlag des BÖLW drei Viertel der Düngemittel mineralischen Ursprungs sein. Bei »Basis-Plus« sind 50 Prozent erlaubt. Und in der »Bio«-Stufe müssen die Betriebe komplett auf chemisch-synthetischen Stickstoff- oder hochlösliche Phosphordünger verzichten.
Mehr Bio vor Ort: Landwirt:innen wollen
An den Landwirt:innen werde das 30-Prozent-Ziel jedenfalls nicht scheitern, glaubt Röhrig: »Die wollen ja. Und die Verbraucher übrigens auch.« In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln mehr als verdoppelt. Derzeit wird die gestiegene Nachfrage nicht zuletzt mit Importen gedeckt. Vor allem Spanien, Italien und Frankreich haben sich schneller auf den wachsenden deutschen Markt eingestellt als die hiesige Branche. Denn die ist schwerfällig: Mehr als 50 Prozent der landwirtschaftlichen Verkaufserlöse in Deutschland werden mit tierischen Produkten gemacht. Eine Hähnchenmast auf Bio umzustellen, ist aber viel schwieriger als etwa einen Gemüsebetrieb: Für die gleiche Zahl an Tieren braucht man rund 60 Prozent mehr Platz, muss ein Drittel des Futters selbst erzeugen und es dauert doppelt so lange, bis die Bio-Hähnchen so viel Fleisch angesetzt haben wie die konventionellen Exemplare.
Von Österreich und Dänemark lernen
Mit der intensiven Viehwirtschaft lassen sich daher keine schnellen Erfolge erzielen, so die Einschätzung von Gerold Rahmann vom Thünen-Institut. Sie nachhaltiger zu gestalten, sei natürlich trotzdem wichtig, betont er. Immerhin verschlingt sie extrem viele Ressourcen. Im Obst- und Gemüseanbau geht die Umstellung schneller. Doch in Deutschland wachsen nur auf rund 200.000 Hektar Obst und Gemüse. Bei einer landwirtschaftlichen Fläche von insgesamt 16,6 Millionen Hektar fällt das kaum ins Gewicht. Das größte Potenzial sieht Rahmann daher in extensiv genutzten Flächen — also zum Beispiel Weiden, auf denen Mutterkühe oder Schafe stehen. Diese seien momentan nur zu einem geringen Teil öko-zertifiziert, obwohl der Schritt zu Bio bei vielen klein sei. Oft liegen sie nämlich in Natur- oder Landschaftsschutzgebieten und erfüllen etliche Vorgaben der EU-Öko-Richtlinie bereits. Eine halbe Million Hektar ließe sich so ohne große Mühen als Bio-Fläche gewinnen, schätzt der Agrarökonom.

Außer-Haus-Verpflegung als Hebel nutzen
In Österreich beträgt der Anteil der Bio-Fläche schon heute 27 Prozent — europaweit liegt das Land damit auf Platz eins. Und bis 2030 sollen noch einmal acht Prozent dazukommen. Die österreichische Politik habe den Ökolandbau in den vergangenen zehn Jahren viel besser unterstützt, als das in Deutschland der Fall gewesen sei, meint Rahmann. Estland und Schweden haben die 20-Prozent-Marke ebenfalls bereits geknackt. Und auch von Dänemark lässt sich lernen: Dort ist der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln pro Haushalt doppelt so hoch wie in Deutschland. Ein Grund: der hohe Anteil von ökologischen Lebensmitteln in der Außer-Haus-Verpflegung. In Kopenhagen liegt der bei bis zu 90 Prozent — in Deutschland bei nur etwa einem Prozent, vermutet Rahmann. Genau erfasst wird die Zahl nämlich nicht. Nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums essen jeden Tag etwa sechs Millionen Deutsche außer Haus — in der Schule, in Kitas, Krankenhäusern, Altenheimen, Firmen und Behörden. Ein riesiges Potential, dass nun gehoben werden soll. So können Kantinen, die künftig mehr oder zum ersten Mal Bio-Produkte anbieten wollen, zum Beispiel Fördergelder beantragen. Ein neues Siegel soll den Gästen auf einen Blick zeigen, wie viel Bio im Restaurant oder der Mensa auf den Tisch kommt.
Mehr Bio wäre bezahlbar
Ein häufiger Einwand: Wer soll das bezahlen? Rahmann ist überzeugt, dass ein höherer Bio-Anteil nicht einmal teurer sein muss: »Es ist möglich, zum gleichen Preis einen guten Teil Öko in die Kantinen zu bringen.« Erste Voraussetzung: Weniger Fleisch, denn das kostet in Bio-Qualität einfach mehr als konventionelles. Für das Wohl der Tiere und auch für unsere Gesundheit wäre das gar nicht mal schlecht. Denn der aktuelle Fleischkonsum von rund 50 Kilogramm pro Kopf und Jahr liegt ohnehin weit jenseits der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (die lautet: maximal 15 bis 30 Kilogramm). Bisher kosten Bio-Menüs oft auch einfach deshalb mehr, weil die Küchen die Zutaten für ein Gericht bei verschiedenen Einkaufsquellen einzeln zusammensuchen und einkaufen müssen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium will Großküchen deshalb auch dabei helfen, Netzwerke mit lokalen Bio-Produzenten aufzubauen und zu erhalten.

Bio-Lücke auch im Handwerk
Netzwerken, das ist ein Ansatz, von dem nicht nur die Außer-Haus-Verpflegung profitieren könnte: Denn in Deutschland gibt es nicht nur zu wenige Bio-Höfe. Auch im Handwerk fehlen Betriebe, die auf Bio spezialisiert sind. »Das geht von der Schlachterei bis zum Kartoffelschälbetrieb«, sagt Peter Röhrig vom BÖLW. Mühlen, Bäckereien, Molkereien — all das ist in vielen Regionen Mangelware. Um die Wertschöpfungsketten wiederzubeleben, kann Rahmann sich eigens eingestelltes Personal vorstellen, das die Landwirtschaftsbetriebe, Mühlen und Bäckereien einer Region zusammenbringt und zum Beispiel bei der Zertifizierung und bei Werbekampagnen unterstützt. Oder Großküchen dabei hilft, sich zusammenzuschließen, sodass sich der Kartoffelschälbetrieb vielleicht doch lohnt. Handlungsbedarf sieht Röhrig auch in der Aus- und Weiterbildung. Weil Bio-Produkte nicht so stark genormt und generell vielfältiger seien als konventionelle Ware, brauche es oft mehr Know-how, um sie zu verarbeiten. Dieses Bio-Wissen müsse im Handwerk ein fester Teil der Ausbildung werden, findet Röhrig.
Vielfalt auf dem Acker braucht Vielfalt im Regal
Und letztendlich brauche »die Vielfalt, die wir auf dem Acker wollen, auch die Vielfalt im Regal«, sagt er. Wie die aussehen kann, das zeigt der Bio-Fachhandel seit Jahrzehnten. In den Regalen der Naturkostläden, Bio-Hofläden und Bio-Supermärkte gibt es eben nicht nur Bio-Milch und Bio-Möhren, sondern dort gehören Produkte wie Lupinenaufstriche oder eingelegte Ackerbohnen längst zum Standardsortiment. Dass auch der restliche Einzelhandel ökologische Ware anbietet, sei ebenfalls wichtig, betont Röhrig: »Jeder sollte die Möglichkeit haben, zu einem Bio-Produkt zu greifen — auch wenn gerade kein Bioladen in der Nähe ist.« Denn an jedem Produkt hängen ein paar Quadratmeter Biofläche, die ohne chemisch-synthetische Pestizide, ohne mineralischen Dünger und ohne Gentechnik bewirtschaftet wurden. Und jeder Quadratmeter zählt.
→ Theresa Horbach