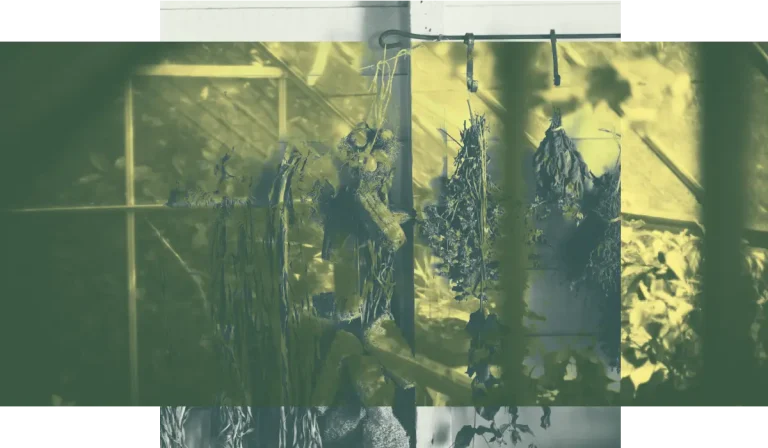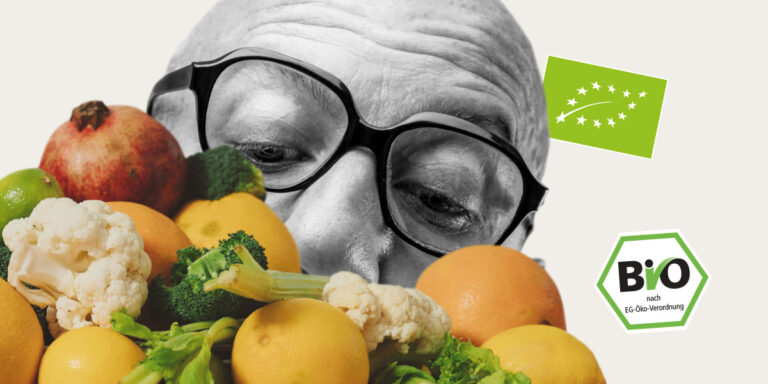Keine Pestizide und kein Kunstdünger — das sind zwei Grundpfeiler des ökologischen Landbaus. Kein Gift auf das zu sprühen, was Lebensmittel werden soll, das leuchtet spontan ein. Aber was ist verkehrt am mineralischen Dünger, auch Kunstdünger genannt? Schließlich sollen die Pflanzen doch ordentlich wachsen? Um den Bio-Anbau zu verstehen, lohnt sich ein Blick nach unten. Unter unseren Füßen ist nämlich so einiges los: In nur einem Teelöffel Erde können sich bis zu einer Billion Organismen tummeln — Bakterien, Pilze, Würmer und Insekten, je mehr desto besser. Ein komplexes Ökosystem, das selbst ein Lebensraum ist und Pflanzen wachsen lässt. Synthetisch hergestellte Dünger bringen dieses ausgeklügelte Ökosystem aus dem Gleichgewicht — mit Konsequenzen letztlich auch für uns.
180 Millionen Tonnen Kunstdünger
»Es gibt viele verschiedene Arten von Kunstdünger«, erläutert Sarah Symanczik, Wissenschaftlerin beim Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL). »Stickstoff, Kalium und Phosphor sind dabei die gängigsten Sorten und können untereinander kombiniert werden.« Wenn es regnet und die Kügelchen mit Wasser in Verbindung kommen, lösen sie sich auf und versickern im Boden. Die wachstumsfördernden Nährstoffe stehen dann sofort für die Pflanzen auf dem Feld bereit.
Die Grundlagen für die Entwicklung des Kunstdüngers wurden parallel zur Industrialisierung bereits im 19. Jahrhundert gelegt. Damals galten Kunstdünger als Hoffnungsträger und bis heute als unverzichtbar: »So gut wie alle Betriebe, die nicht Bio sind, düngen mineralisch«, sagt Sarah Symanczik. Im Wirtschaftsjahr 2020/21 wurden in Deutschland laut Statistischem Bundesamt insgesamt 1,27 Millionen Tonnen Stickstoffdünger, 0,19 Millionen Tonnen Phosphatdünger und 0,45 Millionen Tonnen Kalidünger abgesetzt. Die weltweite Nachfrage nach mineralischen Düngemitteln belief sich im Jahr 2019 laut Jahresbericht der International Fertilizer Association auf über 180 Millionen Tonnen.
Konsequenzen für Bodenleben und Wasser
Doch das Wachstum hat seinen Preis: »Kunstdünger ernährt die Pflanzen, aber nicht den Boden. Organismen wie Pilze und Bakterien, Insekten und Würmer sterben ab, die Biodiversität im Boden nimmt ab«, sagt Symanczik. Der verarmte Boden wird anfälliger, kann zum Beispiel bei Starkregen weniger Wasser binden und und trocknet schneller aus.
Ein weiteres Problem: »Wenn viel Regen kommt, setzt sich auf einmal eine große Menge des Kunstdüngers im Boden frei«, sagt Symanczik. »Die Pflanzen können aber nur eine gewisse Menge aufnehmen.« Der überschüssige Dünger gelangt über das Sickerwasser ins Grundwasser und damit in das Trinkwasser. Gelangen die Stoffe in Flüsse und Seen, werden diese überdüngt und können kippen. »Die Überdüngung der Gewässer mit Phosphor ist eines der größten Probleme, weil es ein übermäßiges Wachstum von Algen und Wasserpflanzen auslöst«, teilt das Umweltbundesamt auf seiner Website mit und fordert eine Veränderung der Düngepraxis.
Endlich, schädlich, aufwendig
Und bereits vor dem Ausbringen auf dem Feld haben mineralische Dünger Konsequenzen für die Umwelt. So werden Kalium und Phosphor durch Säuren aus Gestein gewonnen. Und: »Die Rohstoffe kommen überwiegend aus China, Russland und Marokko. Sie sind endlich und werden nicht ewig zur Verfügung stehen. Der Abbau ist energieaufwendig und die betroffenen Gebiete werden durch den Bergbau zerstört«, erklärt Symanczik.
Die Herstellung des Grundstoffs für synthetischen Stickstoffdünger erfolgt bis heute im nach den Erfindern benannten Haber-Bosch-Verfahren, das bereits 1910 von BASF zum Patent angemeldet wurde (die konventionelle Landwirtschaft ist von wenigen großen Konzernen abhängig — aber das würde den Rahmen dieses Artikels sprengen). Das Haber-Bosch-Verfahren ist ausgesprochen energieaufwendig und zum Einsatz kommen ganz überwiegend fossile Energien — ein Grund dafür, dass die Mineraldüngerpreise mit Beginn des Ukraine-Kriegs explodierten. Und damit nicht genug: Wird der ausgebrachte Stickstoff im Boden abgebaut, werden große Mengen Lachgas freigesetzt, ein Treibhausgas, das als etwa 300-mal klimaschädlicher gilt als CO2. Laut einer Studie der University of Cambridge aus dem Jahr 2023 verursachen die Produktion von synthetischem Stickstoffdünger sowie die anschließende Freisetzung von Lachgas jährlich über eine Milliarde Tonnen CO₂-Äquivalente — ungefähr so viel wie der gesamte internationale Flugverkehr in einem Jahr.
Alternative Wachstumsstrategien
Aber gibt es Alternativen? »In der ökologischen Landwirtschaft sind Kunstdünger nicht erlaubt«, sagt Symanczik. »Stattdessen kommen organische Dünger zum Einsatz.« Dazu zählen Gülle und Mist, Hornmehl, Federmehl oder Blutmehl, aber auch Leguminosen, also Hülsenfrüchtler wie Klee. Die Düngung in der ökologischen Landwirtschaft läuft somit in einem geschlossenen Kreislauf ab und ist Teil eines umfassenden Nährstoffmanagements: Das, was auf die Felder kommt, wird in der Bio-Landwirtschaft angebaut oder fällt als Abfallprodukt an. So wachsen Leguminosen wie Klee als Teil der Furchtfolge und werden anschließend in den Boden eingearbeitet, Gülle, Mist, Hornmehl und Blutmehl sind Abfälle aus der Tierhaltung.
Ein großer Pluspunkt von organischen Düngern: Sie ernähren nicht nur die Pflanzen, sondern kommen auch dem Bodenleben zugute. Das Düngematerial wird von Pilzen, Bakterien, Asseln und Würmern gefressen und verdaut. »Der Humusaufbau und die unterirdische Biodiversität werden gefördert, dadurch werden Nährstoffe besser gespeichert und der Boden kann sich regenerieren«, sagt Symanczsik. Ein gesunder Boden ist resilienter gegen Klimaextreme wie Trockenheit oder starken Regen. Da keine chemischen Stoffe zum Einsatz kommen, bleiben die umliegenden Gewässer sauber. Auch Pflanzen wissen einen gesunden Boden zu schätzen: Je nach angebauter Kultur und Region lassen sich laut Symanczik ohne Kunstdünger teilweise fast die gleichen Erträge erzielen wie im konventionellen Anbau.

Aus Pflanzen für Pflanzen
Federn, Horn, Knochenmehl? Für die wachsende Zahl der vegetarisch beziehungsweise vegan lebenden Menschen eine schwierige Alternative. Die Landwirt:innen Silvia und David Geier gehen deshalb noch einen Schritt weiter. Seit 2014 betreiben die beiden den biozertifizierten Hof Windkind in der Nähe von Berlin. Auf etwas mehr als 50 Hektar bauen sie Walnüsse, Haselnüsse, Hafer, Buchweizen, Linsen und verschiedene Kräuter an, ihre Erzeugnisse verkaufen sie online. »Wir verwenden zur Düngung ausschließlich Pflanzen und organisches Material. Dazu zählen Heu, Stroh, Kräuter, Blätter und Leguminosen wie Klee«, erklärt David. »Auf tierisch-organische Düngemittel wie Gülle, Jauche, Hornmehl oder Blutmehl verzichten wir.« So schließen die beiden die Nährstoffkreisläufe, ohne sich auf die Tierhaltung zu stützen. Der Großteil der eingesetzten Düngemittel stammt dabei direkt vom Hof. Auf bio-veganen Dünger aus Bio-Klee und ‑Luzerne für die Erwerbs- und Hobbygärtnerei setzt auch das sächsische Start-up Kleepura. »Meiner Meinung nach können mit guter und ausgewogener organischer Düngung genauso gute Wachstumsergebnisse erzielt werden wie mit Kunstdünger«, sagt Simon Scheffler, einer der beiden Gründer. Das sieht Bio-Bauer David Geier genauso: »Während die konventionelle Düngung in kurzen Zeiträumen und an schnelles Wachstum denkt, setzt der Ökolandbau auf lange Zyklen und nachhaltigen Anbau.«
Erfolgreiche Umstellung
Dass sich der Verzicht auf Kunstdünger langfristig lohnt, bestätigen auch Stefanie und Peter Riegg vom Gradhof Kösching. Die beiden haben den Hof in Bayern 2020 übernommen und auf ökologischen Landbau umgestellt. Seit 2023 sind sie Bioland-zertifiziert. »Die konventionelle Landwirtschaft beruht auf Symptombehandlung«, findet Stefanie Riegg. »Die Probleme beginnen beim synthetischen Dünger. Die Pflanzen werden in der Regel größer und ertragreicher, jedoch auch schwächer gegenüber Krankheiten und Schädlingen. Die Spritzmittel sollen diese Probleme dann lösen, bekämpfen aber nur die Symptome.« Ein endloser Teufelskreis. Deshalb düngen die beiden heute mit Leguminosen, Luzerne und Mist von ihren Pferden. Auf circa 95 Hektar baut die Familie Winterweizen, Dinkel, Mais, Winterhafer, Sommerhafer, Soja und Erbsen an. »Die Düngung umzustellen war nicht das große Thema. Die größte Herausforderung ist es, die kaputten Böden wieder zu regenerieren. Dies zu bewerkstelligen kann Jahrzehnte in Anspruch nehmen«, so Stefanie Riegg. Bei den beiden ging es etwas schneller: Schon jetzt lobt sie ihre guten Böden und ist mit den Felderträgen zufrieden.
Weniger Kunstdünger durch bewusstes Einkaufen
Der Verzicht auf Kunstdünger kommt dem Boden und der Umwelt ebenso zugute wie Landwirt:innen und Verbraucher:innen. »Das ökologische Gärtnern und die Bio-Landwirtschaft versuchen einen nachhaltigeren und zukunftsorientierteren Umgang mit dem Boden, sowie der Flora und Fauna. Dadurch ist es aus meiner Sicht auch ein Versuch eines etwas gerechteren Wirtschaftens, insbesondere dann, wenn wir an die zukünftigen Generationen denken«, sagt Simon Scheffler.
Ob in Zukunft mehr landwirtschaftliche Betriebe auf den Einsatz von Kunstdünger verzichten, hängt neben den politischen Rahmenbedingungen vor allem von unseren Kaufentscheidungen ab. »Bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern im Supermarkt muss ein Bewusstsein entstehen«, sagt David Geier vom Hof Windkind. »Werden Bio-Lebensmittel gekauft und nachgefragt, werden mehr Betriebe auf Bio umstellen. Dann nimmt auch der Einsatz von Kunstdünger mitsamt seinen verheerenden Auswirkungen ab.«
→ Katrin Brahner