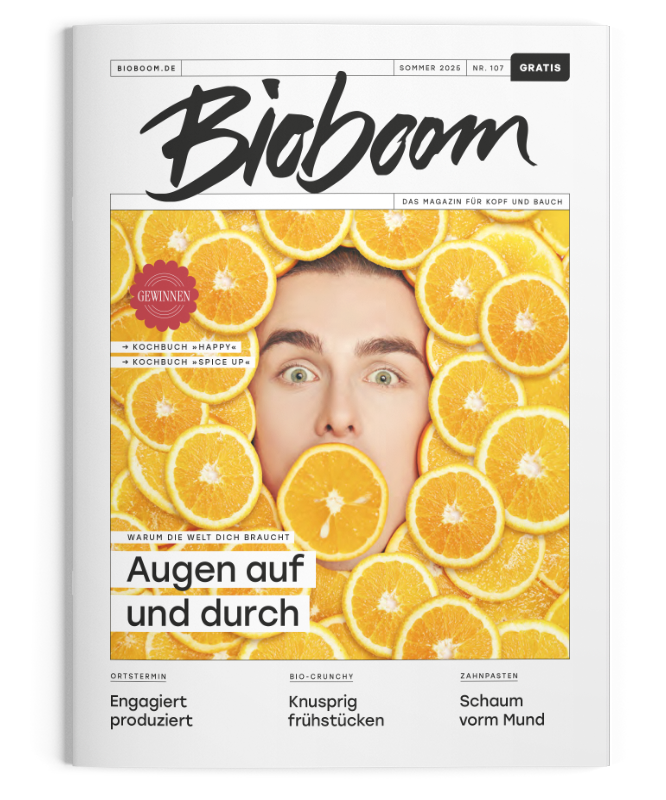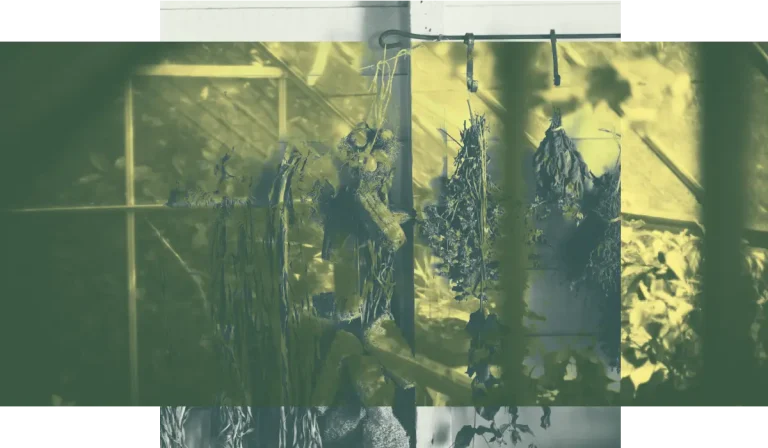![]()
Der Wecker klingelt, ein neuer Tag beginnt: aufstehen, frühstücken, zur Arbeit fahren, von einer Deadline zur nächsten hangeln, abends einkaufen, Freund:innen treffen, vielleicht noch zum Sport. Zwischendurch bestätigt ein Blick in die Nachrichten-App, was man ohnehin längst wusste: eine Krise jagt immer noch die nächste. Dann irgendwann viel zu spät und viel zu müde ins Bett fallen — endlich, der Tag ist geschafft. Aber war da nicht noch was? Ach ja, stimmt: die Welt will ja auch noch gerettet werden, Klimakrise und so. Dafür ist es doch aber eh längst zu spät, oder? Und sowieso: Allein kann ich ja doch nichts ausrichten, das ist auch alles viel zu kompliziert.
So oder so ähnlich geht es vielen Menschen aktuell. »Man könnte von einer allgemeinen Nachhaltigkeitsmüdigkeit sprechen, denn viele empfinden die Unlust, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen«, sagt Lea Dohm. Die Psychologin betreut bei der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit das Themenfeld Mentale Gesundheit und forscht zu den psychischen Folgen der ökologischen Krisen. »Die Menschen sind zunehmend belastet durch die Weltkrisen und den eigenen Alltag. Das Thema Nachhaltigkeit droht dabei, unter den Tisch zu fallen.«
Lücke zwischen Wissen und Handeln
Interessant ist: Die meisten von uns wissen um die Drastik der Krisen, kommen aber dennoch nicht ins Handeln. Das zeigt zum Beispiel der »Nachhaltigkeitskompass 2023« des Beratungsunternehmens Instinctif Partners und der Marktforschungsfirma Truth. Dabei wurden 1.000 deutsche Bürgerinnen und Bürger zu den Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel befragt. 84 Prozent machen sich in Sachen Umweltverschmutzung und Klimawandel konkret Sorgen um die Zukunft. Trotzdem gab nur etwa die Hälfte der Befragten an, ein nachhaltiges Leben zu führen.
Eine YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2023 kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Auch hier gab ein Großteil der jeweils mehr als 1.000 Bürgerinnen und Bürger aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Dänemark, Schweden, Spanien und Italien an, über den Klimawandel und seine Auswirkungen »sehr besorgt« oder »ziemlich besorgt« zu sein. Und auch laut dieser Umfrage, waren nur wenige Menschen dazu bereit, konkret Konsequenzen für ihren Lebensstil zu ziehen.
![]()

Warum so müde?
Woran liegt‘s? Zum einen werde das eigene Wissen schnell überschätzt, sagt Lea Dohm: »Die psychologische Forschung zeigt: 90 Prozent der Menschen in Deutschland haben verstanden, dass die Klimakrise ein ernstes Problem ist, aber nur 10 bis 15 Prozent sind sich auch der zeitlichen Dringlichkeit bewusst.« Hinzu kommt die Konkurrenz der vielen parallel laufenden Krisen: »Wir haben nur ein gewisses Maß an Bedrohungen, mit denen wir umgehen können. Liegen viele Bedrohungen gleichzeitig vor, beschäftigen wir uns eher mit den Krisen, die gefühlt dringlicher sind«, sagt Isabella Uhl-Hädicke. Die Umweltpsychologin forscht unter anderem in den Bereichen Klimakommunikation und Umweltbildung. In ihrem Buch »Warum machen wir es nicht einfach?« widmet sie sich der Psychologie der Klimakrise. Das Gefühl, verzichten zu müssen, sei auch so eine Sache: »In schwierigen Zeiten wollen wir uns nicht noch zusätzlich etwas auferlegen. Wir wollen nicht verzichten, sondern das scheinbar gute Leben spüren und ohne schlechtes Gewissen weitermachen wie bisher«, so Uhl-Hädicke. Auf das leckere Fleischgericht oder den Flug in den Urlaub verzichten? Nein, danke. Das jetzt nicht auch noch.
Wir brauchen positives Feedback
Demotivierend sei auch, dass die positiven Folgen des eigenen nachhaltigen Handelns nicht unmittelbar zu spüren sind. »Wenn ich auf den Flug verzichte, bekomme ich nicht direkt positive Gefühle. Wenn ich in das Flugzeug steige und in Richtung Urlaub aufbreche, hingegen schon«, so Uhl-Hädicke. Das sei vergleichbar mit Sport: Das Training kann schweißtreibend und anstrengend sein. Die positiven Folgen des Workouts spüren wir erst später. Sitzen wir aber mit der Tafel Schokolade auf der Couch, machen sich die positiven Gefühle sofort bemerkbar — obwohl die späteren Folgen für den Körper negativ sind. »Die Klimakrise kann Stress machen und Gefühle wie Angst, Ärger und Traurigkeit auslösen«, fasst Lea Dohm zusammen. Um mit dem Druck, der Angst und den Schuldgefühlen umzugehen, möchten wir uns entlasten und sagen uns: »Es ist doch eh schon zu spät«, »Die anderen machen doch auch nichts« oder »Allein kann ich sowieso nichts ausrichten«.
![]()
»In schwierigen Zeiten wollen wir uns nicht noch zusätzlich etwas auferlegen. Wir wollen nicht verzichten, sondern das scheinbar gute Leben spüren und ohne schlechtes Gewissen weitermachen wie bisher.«
Müdigkeit auch am Bio-Regal spürbar
Auch wenn es um Lebensmittel geht, macht sich eine gewisse Nachhaltigkeitsmüdigkeit bemerkbar. So zeigt eine Studie des Bundesprogramm Ökologischer Landbau (BÖL), dass gerade einmal 60 Prozent der insgesamt 2.000 befragten Personen über Grundwissen zur Prozess- und Produktqualität von Bio-Produkten verfügen, ein Fünftel gab an, überhaupt nichts über Bio-Qualität zu wissen. Dazu mischt sich ein Misstrauen in Bio-Produkte: Laut der BÖL-Studie ist nur jede dritte befragte Person davon überzeugt, dass die in Deutschland verkauften Bio-Produkte tatsächlich Bio sind.
Die Nachhaltigkeitsstudie der Rewe-Group bestätigt diese Entwicklung. Die Studie zeigt, dass die Präferenz für Bio-Nahrungsmittel zwischen den Jahren 2021 und 2023 leicht zurückgegangen ist, genauso wie die Bereitschaft, mehr Geld für Bio auszugeben. Basis für die Erhebung waren 30.000 Haushalte.
Laut Sabine Loch ist diese Entwicklung unter anderem auf die vielen Ansprüche im Hinblick auf die eigene Ernährung zurückzuführen. Sie ist Psychologin und Unitdirector Food am Rheingold Institut, einem deutschen Markt- und Medienforschungsinstitut. »Mittlerweile haben viele Menschen genug von den zahlreichen Ernährungsidealen. Letztlich kann man sich heutzutage gar nicht mehr ernähren, ohne irgendetwas falsch zu machen. Sie suchen unbewusst Entlastung von den vielen Ansprüchen, ohne sich dabei schlecht zu fühlen«, sagt sie. So würde circa die Hälfte der Verbraucherinnen und Verbraucher nach dem Ernährungsprinzip des lustvollen Pragmatismus leben. Das bedeutet: »Das Leben diktiert mir meinen Ernährungsstil: Wenn ich Zeit und Geld habe, lebe ich gesund und nachhaltig. Am Monatsanfang wird vielleicht mehr Bio gekauft als am Ende«, so Sabine Loch.

Impact statt Burnout
Auf der einen Seite haben wir also die Klimakrise, der wir uns vollauf bewusst sind. Auf der anderen Seite behindern uns psychologische Mechanismen dabei, aktiv etwas zu verändern. Was aus dieser Spirale helfen kann: den eigenen Perfektionismus ablegen. »Wir haben ständig Angst, etwas falsch zu machen. Dabei müssen wir nicht immer perfekt sein. Wir dürfen uns erlauben, zu experimentieren, einen Schritt nach dem anderen zu machen, den Druck rauszunehmen«, rät Kerstin Mayer. Als Nachhaltigkeitscoach begleitet sie Menschen auf ihrem Weg in einen grüneren Alltag. Ihr Motto: Impact statt Burnout. Hilfreich sei, sich auf das Positive zu konzentrieren, sich die Welt so vorzustellen, wie sie im Optimalfall aussehen würde — und dieses Bild als Motivation zu nehmen. Denn: »Das Abwehren und Sorgen machen bringt uns in einen Stressmodus, in dem wir nicht mehr reagieren können«, so Mayer.
Wer sich diese beste Version der Welt von morgen ausmalt, merkt schnell, dass wir am Ende alle das gleiche Bedürfnis haben: Wir wollen in Frieden, in einem guten Kontext miteinander leben. Auch nachfolgende Generationen möchten das. Und so wird aus dem Engagement für das Klima ein Engagement für eine gute Zukunft, in der auch unsere Kinder und Enkelkinder noch glücklich existieren können. »Wir leben auf Pump der zukünftigen Generation, wenn wir uns nicht nachhaltig verhalten«, fasst Kerstin Mayer zusammen.
![]()
»Es ist naturwissenschaftlich bewiesen, dass wir noch ganz viel retten können. Wir sind gerade in den entscheidenden Jahren. Wer sich zurücklehnt und sagt, es ist zu spät, entzieht sich der Verantwortung.«
Gemeinschaft, Faktenchecks und Pausen
Wer langfristig dranbleiben möchte, tut sich am besten mit anderen Menschen zusammen. »Nichts nimmt uns so schnell den Wind aus den Segeln, als das Gefühl, allein zu sein«, sagt Uhl-Hädicke. »Eine Gruppe hingegen kann uns mitreißen, uns Mut geben. Auch auf den sozialen Medien können wir Menschen folgen, die ähnliche Ziele haben wie wir.«
Verlässt einen doch mal der Mut, helfen Faktenchecks. Sie entkräften schnell das Argument, dass es ja eh schon zu spät sei und sich Veränderung sowieso nicht mehr lohnt. »Es ist naturwissenschaftlich bewiesen, dass wir noch ganz viel retten können. Wir sind gerade in den entscheidenden Jahren. Wer sich zurücklehnt und sagt, es ist zu spät, entzieht sich der Verantwortung«, so Dohm.
Genauso wichtig, wie ins Handeln zu kommen, sind Pausen. »Wir müssen auch nachhaltig mit uns selbst umgehen«, sagt Uhl-Hädicke. »Das heißt, ich darf auch mal abschalten und Feierabend machen, mich mit etwas anderem beschäftigen als der Klimakrise.«
Bio als wirksamer Hebel
Schließlich hilft es auch, sich klarzumachen, dass Nachhaltigkeit eben nicht Verzicht bedeutet — im Gegenteil: Wer nachhaltiger lebt, gewinnt auf vielen anderen Ebenen. Wer zum Beispiel öfter mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zur Arbeit fährt, spart nicht nur Geld für Sprit, sondern tut auch etwas für die eigene Gesundheit.
Gleiches gilt für eine gesunde Ernährung mit Bio-Lebensmitteln. Obst und Gemüse aus Bio-Anbau schmeckt gut. Gleichzeitig wird die Umwelt durch den Verzicht auf Pestizide entlastet. So hat unsere Kaufentscheidung direkte Auswirkungen auf die Umwelt: Wir können entscheiden, ob wir den Bio-Apfel ohne Pestizide oder den konventionellen Apfel kaufen. Damit können wir auch ein Stück weit mitentscheiden, ob Pestizide in unser Grundwasser und in die Umwelt gelangen oder eben nicht. »Die Kombination, gesünder zu essen und mehr Bio sowie unverarbeitete Lebensmittel zu kaufen, ist ein sehr fruchtbarer Weg, der das Budget nicht sprengt«, findet auch Kerstin Mayer.
Zum Vorbild werden
Also, ja: Die Auseinandersetzung mit den Themen Nachhaltigkeit und Klimakrise kann anstrengend, stressig und angsteinflößend sein. Es stimmt aber auch: Informieren und ins Handeln kommen, das hilft. »Die Auseinandersetzung mit dem Klima ist im ersten Schritt belastend, wird dann aber besser, wenn wir die Handlungsmöglichkeiten kennen«, bestätigt Lea Dohm. Wer es schafft, diese Handlungsmöglichkeiten wahrzunehmen, wird mit dem guten Gefühl belohnt, Verantwortung zu übernehmen, auch für künftige Generationen. Als schöner Nebeneffekt verbessert sich die eigene Lebensqualität, zum Beispiel durch mehr Bewegung und eine gesunde Ernährung mit Bio-Lebensmitteln gleich mit.
Und: Wer trotz aller Hindernisse zumindest ein bisschen nachhaltiger lebt, wird zum Vorbild für das eigene Umfeld. So verliert das Argument »Die anderen machen doch auch nichts« mehr und mehr an Kraft. Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat diesen Effekt zusammengefasst: »Wir sind die Hoffnung, die jemand anderes so dringend braucht.«
→ Katrin Brahner