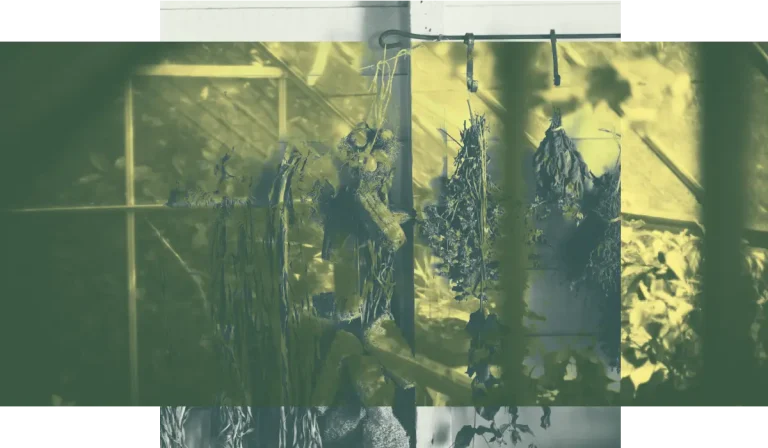Der Klimawandel ist in Deutschland bereits heute konkret erlebbar. Das Jahresmittel der Lufttemperatur ist im Flächenmittel von 1881 bis 2018 statistisch gesichert um 1,5 °C angestiegen. Die Sommer 2003, 2015 und 2018 waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Zahl der »Heißen Tage«, an denen die höchste gemessene Temperatur 30 °C oder mehr beträgt, hat signifikant zugenommen. 2003 starben etwa 7.500 Menschen mehr, als ohne Hitzewelle zu erwarten gewesen wäre, so die Bundesregierung in einem im November 2019 veröffentlichten Monitoringbericht. Zu diesem Zeitpunkt schien die Dramatik des Geschehens im gesellschaftlichen und politischen Bewusstsein angekommen zu sein.
Der Klimastreik von Fridays for Future im September 2019 brachte über eine Million Menschen auf die Straße. Ende Dezember die ersten Zeitungsmeldungen über eine mysteriöse Lungenkrankheit im fernen Wuhan. Im März 2020 werden Schulen, Geschäfte und Grenzen geschlossen, es gelten Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen. Eine Gesellschaft, die noch wenige Wochen zuvor diskutierte, ob ein Tempolimit von 130 auf Autobahnen nicht als unzulässiger Eingriff in die persönlichen Freiheitsrechte zu werten wäre, war überzeugt: Flatten the curve, gemeinsam halten wir die Kurve flach, sorgen dafür, dass wir Risikogruppen schützen, das Gesundheitssystem nicht überlasten. Geht doch.
Mythos Neubeginn
Eine schwere Erkrankung, ein bitterer Verlust, ein einschneidendes Erlebnis: Danach ein Neustart. Wir alle hören gerne Geschichten, wie Menschen aus schwierigen Situationen heraus komplett neu anfangen, wie Lebensentwürfe einfach umgekrempelt wurden, sich scheinbar feste Wahrheiten verflüssigten und Unmögliches möglich wurde. Es ist verlockend, sich vorzustellen, dass die globale Corona-Krise so ein kollektiver Weckruf für die Menschheit sein könnte: So geht es nicht weiter. Wir wollen das nicht mehr. Das machen wir jetzt anders. Aber leider: Meistens ändern Krisen gar nichts, wie jeder resignierte Allgemeinmediziner aus seiner Praxis berichten kann.
Nach dem ersten Schock wird weiter gefuttert, getrunken, auf dem Sofa gesessen. Und so erleben wir auch jetzt eine enorme Widersprüchlichkeit: Auf der einen Seite haben wir gesehen, wie schnell sich Veränderungen realisieren lassen, wenn die Dringlichkeit nur groß genug ist, und wie schnell wir uns an veränderte Situationen anpassen können. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage: Warum tun wir uns – seit Jahrzehnten – so schwer, auf die Klimakrise zu reagieren, die nach Schätzungen der WHO ab 2030 jedes Jahr 250.000 zusätzliche Todesfälle pro Jahr fordern wird? Es mutet an, wie in der Fabel, in der der Frosch, der in kochendes Wasser geworfen wird, sofort herausspringen will, während er, wenn er allmählich erhitzt wird, geduldig sitzen bleibt, bis er gekocht ist (zur Ehrenrettung der Frösche: Die Geschichte stimmt nicht. Frösche haben einen guten Überlebensinstinkt). Menschen jedenfalls tun definitiv Dinge, die nicht gut für sie sind: Sie essen zu viel Zucker. Sie machen keinen Sport. Und sie ruinieren den Planeten, auf dem sie leben – individuell und global entscheiden wir uns für eine bequeme Gegenwart auf Kosten der Zukunft. Paradoxerweise nehmen wir damit auch das Risiko neuer Pandemien in Kauf.

Zwei Seiten einer Medaille
Denn die Zerstörung von Ökosystemen und der Klimawandel spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, dass sich neuartige Viren verbreiten. Ein Beispiel dafür sei nicht nur Sars-CoV‑2 sondern auch das Ebolavirus, wie der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit in einem Interview der Bundeszentrale für politische Bildung erläutert. »Hier hat der Mensch massiv in den Lebensraum der Wildtiere eingegriffen, ihn vernichtet, in dem er Plantagen angelegt hat oder Massentierhaltung betreibt.« Der enge Zusammenhang zwischen der Zerstörung bestimmter Ökosysteme, der globalen Erwärmung und dem Ausbruch solcher Pandemien sei vielen nicht so klar gewesen, sagt der Forscher und bilanziert: »Die massive Zerstörung unserer Umwelt ist dabei der wesentliche Punkt. Diese Pandemie ist kein Naturereignis, das plötzlich über uns hereinbrach.«
Über unsere Verhältnisse
»Earth Overshoot Day«, zu Deutsch Erdüberlastungstag: Das ist der Tag, an dem die Ressourcen, die unser Planet für ein Jahr produzieren kann, erschöpft sind. Dieses Jahr war er am 22. August erreicht. Damit lag das Datum das erste Mal seit Jahrzehnten später als im vergangenen Jahr – wenn auch nur drei Wochen, wie das Global Footprint Network, das die entsprechenden Daten berechnet, mitteilt. Trotzdem wäre das eine gute Nachricht, wenn die Verschiebung auf einem globalen Umdenken beruhen würde. Tatsächlich sind die durch den Corona-Virus ausgelösten globalen Lockdowns die Ursache. Sie haben zu einem Rückgang der Waldrodung und des Verbrauchs fossiler Brennstoffe geführt.
Seit 1971 lässt sich anhand des Datums verfolgen, wie sehr die Menschheit über ihre Verhältnisse lebt: Damals lag der Erdüberlastungstag am 21. Dezember, seitdem wurde er bis 2019 jedes Jahr früher erreicht. Die Menschheit verbraucht derzeit 60 Prozent mehr als das, was unser Planet erneuern kann – oder so viel, als ob wir auf 1,6 Erden leben würden. Die nationalen Unterschiede sind dabei enorm: Würden alle Menschen so leben wie in Deutschland, bräuchten wir gleich drei Erden – während der globale Erdüberlastungstag 2019 am 29. Juli war, lag er in Deutschland bereits am 3. Mai. »Unsere Bemühungen mit COVID-19 haben gezeigt, dass es möglich ist, den Verbrauchstrend der ökologischen Ressourcen innerhalb kurzer Zeit zu verschieben. Aus dieser Gesundheitskrise und den Diskussionen um einen Wirtschaftsstimulus lernen wir auch neue Strategien für Ressourcensicherheit und menschlichen Wohlstand«, so das Global Footprint Network.
Genug für alle
Wenn die Menschheit, speziell die Bewohner der reichen Industrienationen, sich einig wären, würde es funktionieren? Und wie würden wir leben? Eine mögliche Antwort für den Ernährungssektor liefert die Planetary Health Diet, die 2019 von der EAT-Lancet-Kommission veröffentlicht wurde. Die internationale Kommission von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erarbeitete einen Speiseplan, der sowohl Mensch als auch Planet zugute kommen sollte. Ermutigendes Fazit: Es wäre machbar, bis zum Jahr 2050 ca. 10 Milliarden Menschen gesund zu ernähren, ohne den Planeten zu zerstören. Allerdings: In den westlichen Wohlstandsnationen müssten viele lieb gewonnene Ernährungsgewohnheiten aufgegeben werden. Deutlich weniger Fleisch, Fisch und Milchprodukte, viel mehr Gemüse, Obst, Nüsse und Hülsenfrüchte, im Durchschnitt 2.500 Kalorien pro Tag und Mensch. Die Mengen sind nicht üppig: Ein Ei pro Woche, knapp 200 Gramm Rindfleisch, aber immerhin täglich 300 Gramm Gemüse, 230 Gramm Vollkornprodukte, 50 Gramm Nüsse und 75 Gramm Hülsenfrüchte. Zum Vergleich: Der aktuelle Fleischkonsum in Deutschland liegt bei 60 Kilo pro Kopf und Jahr, das sind ca. 165 Gramm pro Tag.
Neben der individuellen Ernährungsumstellung müsste sich auch die Landwirtschaft verändern und Faktoren wie Wasser, Boden, biologische Vielfalt, Klima, Stickstoff und Phosphor berücksichtigen. Der ökologischen Landwirtschaft kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, so die EAT-Lancet-Kommission, allerdings müsse sie produktiver werden. Die Welternährung so umzustellen, dass sie Mensch und Planet gleichermaßen gerecht werde, sei »nicht weniger als eine neue globale Agrarrevolution«, so Johan Rockström, einer der Vorsitzenden der Kommission und Leiter des Stockholm Resilience Centers. Immerhin, so hat die Kommission errechnet, ließen sich nicht nur die Lebensgrundlagen der Menschheit für die Zukunft sichern„ auch 11 Millionen Todesfälle pro Jahr durch Krankheiten, die durch falsche Ernährung mitverursacht würden, könnten verhindert werden.

Bio-Anbau produktiver machen
Dass Bio-Anbau ein unproduktiver Luxus sei und nur die intensive industrielle Landwirtschaft die Welt ernähren könne – ein (Vor-)Urteil, das die ökologische Landwirtschaft von Anfang an begleitet. Eindrucksvoll entkräftet wurde es bereits 2011 von Felix Prinz zu Löwenstein, damals wie heute Vorsitzender des Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft Deutschland (BÖLW) und selbst Bio-Landwirt. »Was wir uns nicht mehr leisten können, ist eine konventionelle Landwirtschaft, in der wir mehr Ressourcen verbrauchen, als uns zur Verfügung stehen«, so Löwenstein in einem Bioboom-Interview.
In seinem Buch »Food Crash – wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr« analysiert er die Begrenztheit eines Systems, das enorme Mengen klimaschädlicher Gase ausstößt, das Wasser vergiftet, die Artenvielfalt bedroht und die Böden auslaugt. Auch für ihn geht es darum, die ökologische Landwirtschaft produktiver zu machen. Das, so der Landwirt, könne nicht gelingen, wenn der europäische Bio-Anbau eins zu eins global übergestülpt werde – es gelte dabei, sich an örtliche Gegebenheiten anzupassen und auf die jahrhundertealten Erfahrungen kleinbäuerlicher Landwirtschaft zurückzugreifen.
Was kommt nach dem Öl?
Fossile Brennstoffe sind weltweit (noch) die Basis der Industrie und Logistik. Auch für die Lebensmittelproduktion sind sie von zentraler Bedeutung: Erdöl ist Grundlage für die Produktion von Kunstdünger und Pestiziden, ermöglicht weltweite Transporte. Der Verbrauch fossiler Brennstoffe ist nicht nur Treiber für den Klimawandel, sie sind auch eine endliche Ressource. Was kommt, wenn das Erdöl zu Ende geht? Antworten auf diese Frage will die Transition-Bewegung geben. Sie bringt Menschen vor Ort zusammen, die gemeinsam nach Lösungen für die Zeit nach »Peak Oil«, dem Ölfördermaximum suchen. Sie wurde vom britischen Dozenten und Umweltaktivisten Rob Hopkins gegründet. Der Transition-Bewegung geht es darum, unabhängig von fossilen Energieträgern zu werden, regionale und lokale Strukturen zu stärken. Vorbild dabei sind die Gestaltungsprinzipien der Permakultur. Das Ziel sind nicht nur landwirtschaftliche, sondern auch gesellschaftliche Systeme, die so effizient, widerstandsfähig und selbstregulierend sind, wie natürliche Ökosysteme.
Corona-Krise und Klima-Krise nicht gegeneinander aufrechnen
In vieler Hinsicht sind die Corona-Krise und die Klimakrise nicht miteinander vergleichbar. Angesichts des Virus haben Staaten, Gesellschaften, Individuen ihr Verhalten schnell und gründlich verändert – allerdings immer unter der Prämisse, dass es sich um eine begrenzte Krisenreaktion handelt, nach der es wie gewohnt weitergehen kann, selbst wenn zukünftig vielleicht ein paar Meetings mehr virtuell stattfinden und mehr Urlaub im eigenen Land gemacht wird. Konsum und Wachstum bleiben die treibenden Faktoren, an denen gemessen wird, wie gut es uns geht – als Unternehmen oder als Privathaushalt. Maßnahmen wie die aktuelle Senkung der Mehrwertsteuer oder die Forderung nach Anreizen für den Kauf neuer Autos zielen darauf, das Wirtschaftswachstum schnell wieder in Gang zu bringen. Auch wenn viele Stimmen fordern, das neue Wachstum müsse nachhaltig, umweltschonend und klimafreundlich ausgerichtet sein, geht es doch fast immer um Wachstum.
Auch Hersteller und Handel in der Bio-Branche freuen sich selbstverständlich nicht nur über wachsende Flächen im ökologischen Landbau sondern auch über wachsende Umsätze und erfolgreiche Produktkampagnen. Immerhin handelt es sich um eine florierende Branche mit eigenen wirtschaftlichen Interessen – die glücklicherweise weniger konträr zum Allgemeinwohl sind, als in manch anderem Wirtschaftszweig. Entsprechend machen sich Bio- und nachhaltige Unternehmen mit ihrer (recht überschaubaren) Lobby-Macht stark dafür, dass die Corona-Krise nicht nur als Delle in der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern als Impuls für eine Neuausrichtung genommen wird. »Klimaschutz, Solidarität und Corona lassen sich nicht gegeneinander aufrechnen«, so lautet ein Aufruf von nachhaltig-zusammen.de, den bereits über 1.000 Unternehmen, davon viele aus der Bio- und Nachhaltigkeitsbranche, unterzeichnet haben. Sie fordern, Konjunkturprogramme mit dem 1,5‑Grad-Ziel und dem Green Deal der EU zu verknüpfen, erneuerbare Energien auszubauen und in öffentliche Infrastrukturen, sowohl im Verkehr als auch digital, zu investieren sowie wirtschaftliche Anreize für nachhaltige Technologien – kurz, eine zukunftsfähige Wirtschaft.

Die Grenzen des Wachstums
Doch es bleibt eine grundsätzliche Frage: Ist unbegrenztes Wachstum, in welchen Bahnen auch immer, auf einem begrenzten Planeten überhaupt eine Option? Bereits in den 1970er Jahren zeigte der Club of Rome »Die Grenzen des Wachstums« auf und warnte vor dem ökologischen Kollaps. So genannte »Aussteiger« verweigerten sich dem Konsum und zogen aufs Land (die Wurzeln etlicher Bio-Marken liegen dort). Auch heute wird das Konzept des »immer mehr, immer schneller, immer größer« in Frage gestellt: Tiny Houses und die Financial Independence Bewegung, Minimalisten und Maker. Doch politisch-gesellschaftlich sind die Stimmen (noch) leise.
Einer der prominentesten deutschen Vertreter der Post-Wachstumsökonomie ist Professor Dr. Niko Paech. Durch den Rückbau von Wachstum und die Abkehr vom Konsum könnte, so seine Überzeugung, nicht nur eine geringere Abhängigkeit von der globalen Ressourcenkette und damit mehr Krisensicherheit, sondern auch eine höhere individuelle Lebensqualität und mehr sozialer Zusammenhalt entstehen. Den »grünen Konsum« will er in seine Kritik grundsätzlich miteinbezogen wissen: »Alle Versuche, wirtschaftliches Wachstum durch eine Strategie der Begrünung oder Ökologisierung umweltverträglich zu gestalten, sind krachend gescheitert«, so Paech in einem Interview für das MesseMagazin der BioMessen. Eine Ausnahme macht er für den ökologischen Landbau, der kein Wachstumsproblem habe: »Die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen sind begrenzt. Wenn der ökologische Landbau wächst, geht das zu Lasten der konventionellen Landwirtschaft.«
Wenn es uns ernst ist, politisch, gesellschaftlich und individuell unsere Welt enkeltauglich zu machen, dann wird das handfeste Konsequenzen im Alltag jedes und jeder einzelnen haben. Wir würden nicht nur weniger Fleisch essen, sondern auch weniger Avocados. Zu verzichten wäre nicht nur auf das verlängerte Wochenende auf Malle, sondern auch auf das Ayurveda-Spa mit Bio-Essen in Sri Lanka. Wir würden mehr Fahrrad fahren und weniger Auto und das möglicherweise auch, wenn es regnet. Wir hätten es unbequemer. Wären wir unglücklicher? Was bedeutet uns Lebensstandard, wie definieren wir Lebensqualität? Und: Was ist uns unser zukünftiges Selbst wert? Das ist ein Diskurs, den es zu führen gilt. Die Bio-Branche kann dabei mit gutem Beispiel vorangehen – nicht immer. Aber doch oft genug.
→ Jeanine Tovar
Wenn du dich für das Thema Klimawandel interessierst:
→ Hier findest du einen Artikel zum Thema »bewusster Verzicht«
Dieser Beitrag erschien in Ausgabe 88 — Herbst 2020