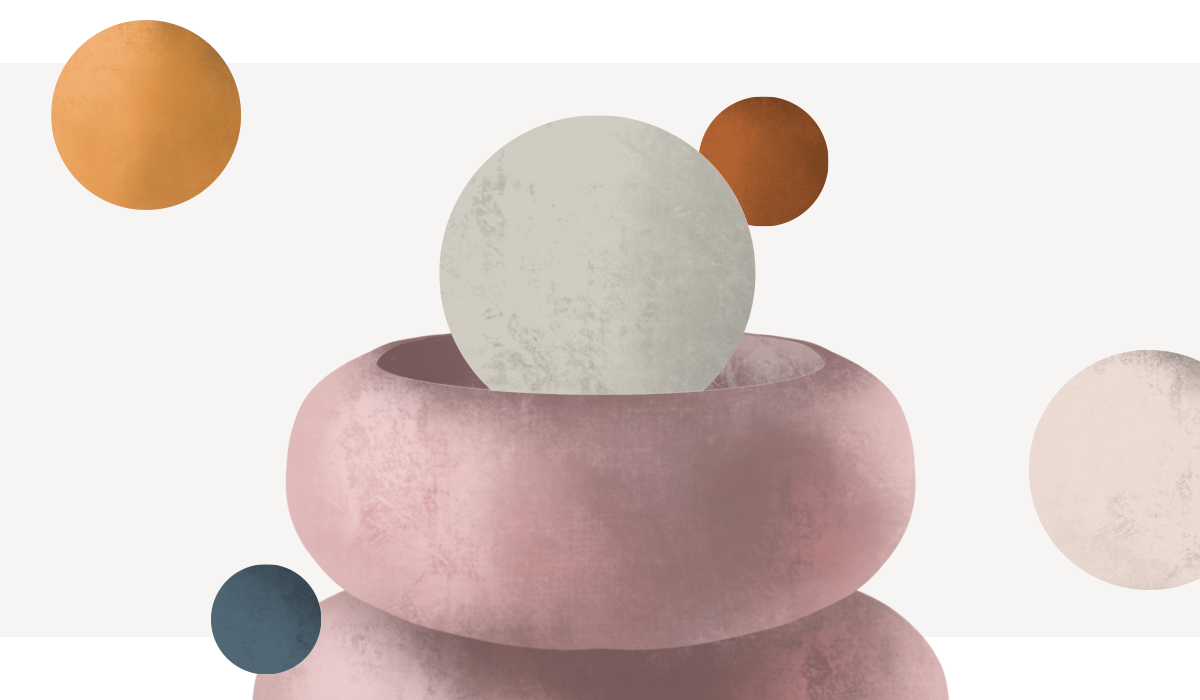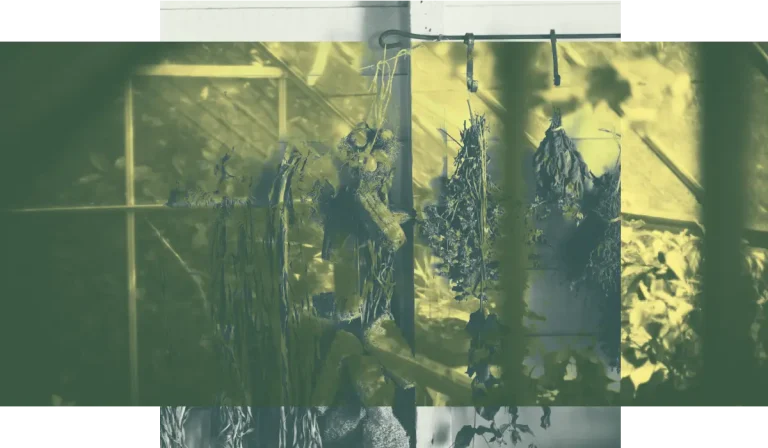Das Wort, um das es geht, ist ziemlich sperrig. Und doch so wichtig, dass es die beiden Mitgründer der Purpose Stiftung, Adrian und Achim Hensen, immer wieder benutzen: Verantwortungseigentum. Die Gesellschafter:innen eines in Verantwortungseigentum geführten Unternehmens sind Treuhänder:innen auf Zeit. Sie stellen die Sinnhaftigkeit und verantwortungsbewusstes Handeln ins Zentrum ihres unternehmerischen Handelns, nicht den Profit. Erzielte Gewinne werden gespendet oder fließen zurück in das Unternehmen. Das Unternehmen als Spekulationsobjekt verkaufen? Ausgeschlossen. »Wir haben diese Form von Unternehmertum nicht erfunden«, sagt Achim, »wir haben ihr nur ein Rechtskleid und eine Sprache gegeben.« Insgesamt sind es mittlerweile rund 25 Menschen in Deutschland, der Schweiz, den USA und Südamerika, die planen, durch ein Neudenken von Eigentum die Wirtschaftswelt zu verändern.
Das Thema auf den Tisch bringen
Adrian und Achim sind vor 36 Jahren als eineiige Zwillinge auf die Welt gekommen. »Wir haben uns also schon sehr früh mit dem Thema Zusammenarbeit auseinandersetzen müssen«, sagt Achim und lacht, »ich bin begeistert davon, was Menschen miteinander ins Leben bringen können.« Trotzdem hätte vor fünf Jahren keiner der beiden gedacht, wie schnell diese Idee die Welt begeistern wird. »Als wir damals über unsere Idee gesprochen haben, wurde uns oft niedlich über den Kopf getätschelt«, sagt Adrian. »Wir haben es uns natürlich gewünscht«, ergänzt sein Bruder, »vor allem den gesellschaftlichen Diskurs, der in den letzten Jahren entstanden ist.« Ihn berührt es, wenn Unternehmer:innen sagen, sie hätten dank der Arbeit von Purpose endlich eine Sprache für das bekommen, was sie sowieso machen wollten.
»Wir waren faktisch fremdbesessen«
Der Weg der beiden Wirtschaftspsychologen führte nach dem Studium jedoch erst einmal in die klassische Unternehmenswelt. »Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, das eine Plattform für Ferienwohnungen betreibt«, sagt Achim. Das Unternehmen sei von 25 auf 140 Mitarbeiter gewachsen. »Wir haben es auf ein neues Level weiterentwickelt, Hierarchien abgeschafft, moderne Formen der Zusammenarbeit umgesetzt.« Er habe viel Lebensenergie und Schaffenskraft in das Unternehmen gesteckt. »Wir waren ein gut funktionierender Mittelständler in Deutschland. Doch dann kam ein großer Player um die Ecke und hat den Laden gekauft.« Das sei ein »Life-Changing-Moment« für ihn gewesen. »Wir waren faktisch fremdbesessen«, sagt Achim, »das Ende der Geschichte: Dieses Unternehmen wurde bis nach Indien weiterverkauft und gehört jetzt zu einem großen Konglomerat.«
In dem Berliner Start-up, in dem sein Bruder Adrian zu der Zeit arbeitete, passierte Ähnliches. »Auch ich habe dort ganz viel Herzblut reingesteckt, aber auch dieses Unternehmen wurde verkauft.« Diese »fundamentalen Brocken« ihrer Lebensgeschichte teilen sich die Brüder. Und sie haben sie geprägt. »Wir haben uns ganz lange mit der Frage beschäftigt, wie man Organisationsstrukturen so weiterentwickeln kann, dass Menschen auf einer Basis von Vertrauen, Sinnorientierung und Eigenverantwortung zusammenarbeiten«, sagt Achim, »und so richtig gut funktioniert das, wenn das Unternehmen selbstbestimmt ist.« Damit rückte die Eigentumsfrage in den Fokus der Brüder.

Die Arbeit begann. Zunächst schauten sie sich Unternehmen in Deutschland an, die Eigentum anders denken. Damit Unternehmen sich selbst gehören, können sie beispielsweise die Firmenanteile in eine Stiftung überführen. »Wir haben uns an den Vorreitern orientiert, das waren Bosch und Ernst Abbe von Zeiss.« Bosch ist zwar als GmbH organisiert, aber rund 92 Prozent der Geschäftsanteile gehören der Robert-Bosch Stiftung, die nicht die Gewinnmaximierung sondern gemeinnützige Projekte in den Mittelpunkt stellt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat sie rund 1,6 Milliarden Euro in diese Projekte gesteckt. Die beiden Brüder fragten sich, warum diese Eigentumsform trotz ihres offensichtlichen Erfolgs nicht schon viel verbreiteter ist. Auf zwei Gründe sind sie gestoßen: Sie ist nicht bekannt genug und relativ schwer umzusetzen.
Purpose statt Profit
Die Purpose Stiftung, die die beiden Brüder zusammen mit Alexander Kühl und Armin Steuernagel 2015 gründeten, ist angetreten, das zu ändern. Ein festes Büro hat die Stiftung noch nie besessen. Sie leistet Ideenarbeit, ist beratend tätig – immer dort, wo sich Menschen treffen, die ihr Potential bündeln wollen, um Sinnstiftendes zu erschaffen. »Wir stellen Open Source Materialien zur Verfügung, schreiben Bücher, organisieren Konferenzen, betreiben Forschung, gehen an die Universitäten«, sagt Achim, »wir helfen und begleiten Unternehmen auf ihrem Weg.« Das Ziel der Stiftung: Eine gesunde Wirtschaft, die dem Menschen dient. Sie sehen sich als Gedankenpartner:innen und Prozessbegleitung, wollen für jedes Unternehmen die passende Eigentumsform finden.
Doch eine Rechtsform für Verantwortungseigentum gibt es in Deutschland noch nicht. Die große Frage war also: Wie kann man es für mittelständische Unternehmen oder Start-ups vereinfachen, dieses Ziel zu erreichen, ohne selber Stiftungskonstruktionen aufzusetzen, die kompliziert und kostspielig sind. »Denn sie können ja nicht wie Bosch unzählige Anwälte über viele Jahren hinweg anstellen, um zu dieser Eigentumsform zu kommen«, sagt Achim. Zugleich sollte die Eigentumsform bindend sein, und zwar über die nächsten Generationen hinaus. »Eine GmbH könnte jederzeit die Prinzipien des Verantwortungseigentums in ihre Satzung übernehmen. Wenn aber in fünf Jahren dem Unternehmen jemand viele Millionen anbietet, könnte es theoretisch trotzdem darauf eingehen. Wir brauchen also eine Form von Verewigungsmechanismus, den Stiftungen normalerweise haben.«
Mit Verantwortungseigentum Unternehmenswerte erhalten
Als Lösung fanden sie einen »Eigentums-Hack«, der Purpose-Unternehmen im klassischen Sinne unverkäuflich macht. Und der funktioniert so: Ein Prozent ihrer Stimmrechte geben die Unternehmen an die Purpose Stiftung ab. Für Änderungen an den Prinzipien des Verantwortungseigentums brauchen sie 100 Prozent Zustimmung von allen Stimmberechtigten. »Und die Stiftung hat nur einen Auftrag: Sie sagt immer nein, wenn diese Prinzipien geändert werden sollen, kann sie also immer ein Veto einlegen und das Eigentum schützen«, sagt Achim. Darüber hinaus hat die Stiftung keinen Einfluss auf Entscheidungen der Unternehmen. Was sonst ziemlich teuer und verwickelt wäre, wird durch diesen »kleinen Trick«, wie ihn die Brüder nennen, recht günstig unkompliziert – und damit auch für Start-ups oder kleinere Betriebe interessant.
Ganz klassisch: Lobbyarbeit und Investments
Nun sei es an der Politik, die rechtlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen in Verantwortungseigentum zu verbessern. Anders ausgedrückt: Das Gründerquartett muss klassische Lobbyarbeit leisten. »Schlussendlich muss es genauso einfach sein, diese Form von Unternehmen zu gründen, wie jede andere. Das ist unser Anliegen«, sagt Achim. Der politische Prozess ist bereits ins Rollen gekommen. Es gab erste Treffen mit Spitzenpolitiker:innen aus unterschiedlichen Parteien. Die Resonanz sei positiv gewesen. Doch noch ist das Unwissen groß, auch bei vielen, die gründen. Oft machten sie die »Mainstream-Start-up-Story«, ohne die Alternativen zu kennen. Dabei möchten viele der Unternehmenslustigen etwas Dauerhaftes schaffen: ohne finanziell lukrativen Exit als Unternehmensziel, etwas das bleibt und die Welt ein Stück besser macht. »Und auch diese Unternehmen müssen sich natürlich selbst tragen«, sagt Achim. »Aber das Maximierende wird rausgenommen«, ergänzt sein Bruder, »und trotzdem ist es keine Eigentumsform für Mönche. Natürlich kann man Wohlstand aufbauen und seine Kinder absichern.« Oft sei – wie bei allen anderen Unternehmen auch – der Zugang zum Kapital entscheidend.
»Wir wollen auch hier einen Beitrag leisten«, sagt Achim, »und haben deswegen die Investmentgesellschaften Purpose Ventures und Purpose Evergreen Capital gegründet.« Sie ermöglichen »machtfreie Investments«, wie sie es nennen. Investoren können zwar Dividendenrechte erwerben, aber keine Stimmrechte. »Investoren spielen eine total wichtige Rolle in der Ermöglichung von Unternehmen in dieser Welt. Doch sie brauchen einen adäquaten Renditeausgleich für das Risiko, das sie eingehen«, sagt Achim, »wenn also jemand in ein sehr risikoreiches Start-up investiert, dann finde ich es fair, dass er oder sie Geld dafür risikoadäquat zurückbekommt.« Große Player wie die GLS Bank oder die BMW Foundation gehörten ebenso dazu wie private Investoren.
Bio-Purpose: »Etwas Gutes und Gesundes erschaffen«
Kein Wunder, dass die neue Eigentumsform in der Bio-Branche gut ankommt. In den USA hat die Investmentgesellschaft Purpose Evergreen Capital bereits einen der größten, unabhängigen Biogroßhändler, die Organically Grown Company auf dem Weg ins Verantwortungseigentum begleitet. »Bio-Unternehmen haben schon einen besonderen Blick darauf, was ein Unternehmen eigentlich ist, und welche Rolle es in der Wirtschaft spielt«, sagt Adrian und sein Bruder ergänzt, »das Streben danach, etwas Gutes und Gesundes zu erschaffen, ist bei Bio-Unternehmen oft inhärent. Sie wollen, dass ihre Mission auch in Zukunft erhalten bleibt und nicht unter einem systemischen Zwang verwässert.«
Doch nicht nur die Unternehmen selbst, auch die Kunden haben an Bio-Firmen höhere Erwartungen. »Es ist ein wertesensibler Markt, in dem es kundenseitig ein hohes Bewusstsein dafür gibt, wie ein Unternehmen wirtschaftet«, sagt Adrian, »und das betrifft auch die Frage, ob der Kunde für das Unternehmen im Mittelpunkt steht oder ob er nur Mittel zum Zweck ist, damit anderswo Profit maximiert werden kann.« In Deutschland haben unter anderem Bio-Pioniere wie Arche Naturprodukte, der Hersteller ökologischer Wasch- und Reinigungsmittel Sonett, die Naturkostsafterei Voelkel, aber auch das Bio-Start-up Gute Kulturen Verantwortungseigentum mithilfe der Purpose Stiftung umgesetzt.
Werteverwandtschaft statt Blutsverwandtschaft
Zu den Profiteuren des Verantwortungseigentums zählen für das Gründerquartett nicht zuletzt die Mitarbeitenden der jeweiligen Betriebe. »Sie gehen morgens zur Arbeit und haben eine ganz andere Form der Sicherheit«, sagt Adrian. »Sie wüssten, wofür sie ihre Lebenszeit und Energie verwenden, und das verändert die Motivation fundamental.« Die Menschen würden eben nicht mehr für das Vermögen eines anderen arbeiten, sondern für eine größere Unternehmensidee. Dass sei auch ein Anreiz für Menschen, dort arbeiten zu wollen.
Auch wenn es um die Unernehmensnachfolge geht, rücken Mitarbeiter:innen als potentielle Nachfolger:innen häufiger ins Rampenlicht. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen müssen oft schließen, weil die Inhaber:innen altersbedingt abgeben wollen oder müssen. Im Verantwortungseigentum könnten die Mitarbeitenden die Geschäftsführung übernehmen – und aus der Firma sozusagen ein Familienunternehmen 2.0 machen.
Eine globale Bewegung für Gleichheit und Fairness
In den nächsten fünf Jahren erhoffen sich die Brüder eine Zunahme des Diskurses auf internationalem Niveau. »Einen fairen Wettbewerb gibt es nur, wenn gleiche Bedingungen für alle herrschen, sowohl beim Zugang zum Kapital als auch bei den rechtlichen Umsetzungsmöglichkeiten«, sagt Adrian. »Eigentlich sollte dann ein Großteil unserer Arbeit überflüssig sein«, ergänzt sein Bruder, »und wir könnten andere coole Sachen machen.«
→ Kristin Kasten
Dieser Beitrag erschien in Ausgabe 90 — Frühjahr 2021