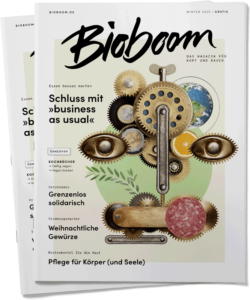Der Geruch von nasser Erde, reifem Obst und frischem Gemüse wabert durch den alten Apfelweinkeller, der in einem Hinterhof im Frankfurter Stadtviertel Eschersheim liegt. An den Steinwänden stehen Holzregale, in denen sich Kisten mit Kartoffeln, Staudensellerie, Zwiebeln und Gurken aneinanderreihen. Alexis Passadakis legt drei Rucksäcke auf den Boden und nimmt einen Zettel in die Hand, der gut sichtbar auf einem Holztisch in der Mitte des Raums liegt. »530 Gramm Tomaten«, liest er und greift in eine gegenüberliegende blaue Kiste, in der sich knallrote Tomaten häufen.
Neben allerlei Gemüse darf der Frankfurter sich heute auch drei Liter Apfelsaft und 100 Gramm Physalis einpacken. »Da freut sich mein 7‑jähriger Sohn, die kommen in seine Frühstücksbox für die Schule.« Alexis ist Mitglied der Solidarischen Landwirtschaft 42, kurz Solawi42. Das Prinzip ist einfach: Die Mitglieder strecken einem Bauernpaar das Geld für Saatgut, landwirtschaftliche Geräte und Löhne vor, teilen somit das wirtschaftliche Risiko des Erntejahres und erhalten im Gegenzug Gemüse frisch vom Feld.
Jeder zahlt, so viel er kann bei der Solawi
Deutschlandweit sind Solidarische Landwirtschaften im Trend. Im Netzwerk »Solidarische Landwirtschaft« sind bundesweit 301 Solawis verzeichnet. Tendenz steigend. In Frankfurt am Main liefert Bauer Arno Eckert vom Birkenhof im naheliegenden Egelsbach jeden Mittwoch feldfrisches Gemüse, manchmal auch Obst, Saft und Eier in das Depot an der Eschersheimer Straße. Die Mitglieder haben dann bis Donnerstagabend Zeit, ihren Anteil abzuholen. Doch nicht jedes Mitglied zahlt den gleichen Preis für seinen Anteil. »Im Schnitt zahlen die Mitglieder momentan 80 Euro im Monat«, sagt Alexis. Wer wie viel zahlt, entscheidet sich in der »Bieterrunde«, die immer vor Beginn des Erntejahres stattfindet. Der Bauer stellt allen Anteilsinhabern die Ausgaben für das kommende Jahr vor, woraus sich ein Durchschnittsbeitrag pro Ernteanteil ergibt. Jedes Mitglied bietet jedoch für seinen Anteil nur so viel, wie es kann. Anonym. »Menschen mit höheren Einkommen werden aufgefordert, mehr zu zahlen«, sagt Alexis. Schließlich solle es auch untereinander eine Solidaritätskomponente geben.
»Momentan haben wir 34 Ernteanteile und ich schätze, dass etwa 90 Personen das Obst und Gemüse konsumieren«, sagt Alexis, der die gut sieben Kilometer von seiner Wohnung ins Depot immer mit dem Fahrrad fährt. Der Politikwissenschaftler, der in Bonn, Berlin und Brighton studiert hat, ist seit vier Jahren Mitglied der Solawi42. »Beim Thema Welthandel spielen landwirtschaftliche Produkte eine große Rolle, weil sie aufzeigen, wie ungerecht unser Welthandelssystem ist«, sagt Alexis. Die Solidarischen Landwirtschaften seien ein guter Ansatz, der zeige, dass es trotz des Preisdrucks des Weltmarkts auch anders gehe.

Solidarisch produziertes Olivenöl
Aus einer Satteltasche seines Fahrrads zieht Alexis einen 5‑Liter-Kanister Olivenöl. »Auch die Olivenöl-Geschichte ist so ein Beispiel dafür«, sagt er und setzt sich auf einen der vielen Holzstühle, die auf dem Hof vor dem Eingang zum Keller stehen. Er nimmt den Kanister in die Hand und zeigt auf einen Aufkleber, der die Unterstützer in Deutschland zeigt, darunter auch die Solawi42. Die Geschichte der außergewöhnlichen Kooperation begann vor vier Jahren. Damals organisierte der Politikwissenschaftler die erste Olivenöl-Lieferung aus dem über 2000 Kilometer entfernten Dorf Daras in der Region Messenien. »Wenn man angesichts der Klimakrise und des Zustands des globalen Ernährungssystems eine Alternative möchte, ist es natürlich primär eine lokale Form«, sagt Alexis, »aber Olivenbäume lassen sich hier eben nicht anbauen.« Deshalb gehe es darum, ökologische, faire und solidarische Infrastrukturen zu schaffen – wenn nötig auch über Deutschlands Grenzen hinaus. »Die Eurozonenkrise hat 2010 zu heftigen Verwerfungen geführt. Das Bruttoinlandsprodukt ist in Griechenland um 25 Prozent eingebrochen.« Danach hätten sich im Land Formen solidarischer Ökonomie entwickelt – auch im Bereich der Landwirtschaft. »Viele Leute sind aus den Städten zurück in ihre Dörfer gekehrt, so entstand ein Nährboden für etwas Neues.«
In Daras haben sich mehrere Kleinbauern zusammengetan, um Olivenöl aus ökologischer Landwirtschaft herzustellen. Das Öl trägt den Namen »Mazi« – »gemeinsam«. Partnergenossenschaften in Athen und Berlin kümmern sich um den Transport und alle steuerrechtlichen Fragen. Die Solawi-Mitglieder in Frankfurt zahlen fünfzig Euro für den Kanister Olivenöl. Davon gehen jeweils fünf Euro an die Genossenschaften in Athen und Berlin und 35 Euro direkt an die Hersteller. »Für die Bäuerinnen und Bauern ist das ein guter Deal«, sagt Alexis, »mittlerweile konnten sie sogar schon eigene Tanks und eine Presse kaufen, müssen also nichts mehr anmieten.« Genauso wichtig sei es, dass die Pflücker fair bezahlt werden. »Die Erntehelfer erhalten oftmals einen ultrageringen Lohn.« Die griechische Olivenöl-Kooperative hingegen zahle faire Gehälter.
Ein Euro pro Liter für humanitäres Projekt
Und es gibt noch einen weiteren solidarischen Aspekt: Die übrigen fünf Euro pro 5‑Liter-Kanister gehen an ein humanitäres Projekt vor Ort. In diesem Jahr war es eine Bürgerinitiative auf Lesbos, die Jugendliche betreut, die im »Dschungel« von Moria lebten, also in den Büschen um das Camp herum. »Noch besser wäre es natürlich, wenn es ein Camp wie Moria gar nicht geben müsste«, sagt Marius, 27, der gerade den Ernteanteil für sich und seinen WG-Mitbewohner abholen will, »aber es gibt es nun mal«, daher unterstütze er das Hilfsprojekt gerne.
Von seinem 5‑Liter-Kanister, den er im letzten Jahr gekauft hat, seien noch zwei Liter über, darum habe er bei der letzten Lieferung im April ausgesetzt. Damals wurden 2900 Liter innerhalb von drei Stunden verteilt. Einer, der gleich mehrere Kanister gekauft hat, ist David, 38, der über den Hof gelaufen kommt und bei Alexis stehenbleibt. »Wir bekommen das Öl erzeugernah geliefert, ohne Großhändler dazwischen. Alle Abläufe sind transparent und auch preislich liegt es voll im Rahmen«, sagt der Familienvater, der seit drei Jahren Mitglied der Solawi42 ist, »und schmecken tut es auch.« Alexis nickt, »es gab auch schon wieder viele Anfragen. Eventuell gibt es im November die nächste Lieferung.«
Saisonal limitierte Vielfalt
Das Olivenöl müssen die Mitglieder der Solawi vorbestellen, ebenso wie den fair gehandelten Bio-Tee aus Indien, um dessen Lieferung sich ein Mitglied der Solawi immer kümmert. Die Lieferung vom Birkenhof hingegen kommt regelmäßig und ist jedes Mal eine Überraschung. »Ich habe hier eigentlich erst richtig gelernt, was regional und saisonal ist«, sagt David. »Bei Haferwurz wusste ich nicht mal, was das ist und Pastinake habe ich als Kind das letzte Mal gegessen«, sagt er und lacht. Alexis geht es ähnlich. »Postelein und schwarzen Rettich kannte ich vorher nicht.« Sein ganzes Ernährungsverhalten habe sich geändert. »Und ich verbringe mehr Zeit in der Küche, auch weil das Gemüse nicht in dem Maße gereinigt und makellos ist.« Der Geschmack mache die Mehrarbeit aber wieder wett. Die Essensplanung für die nächsten Tage beginnt bei Alexis in dem Moment, in dem er den Keller verlässt.
Genauso ergeht es Daniela, 31, die ihre erste Saison dabei ist. »Aber ich finde das tatsächlich spannend, auch dass man herausgefordert wird, etwas Neues zu machen.« Im Winter habe es Winterportulak gegeben, »das ist ein Wintersalat, den ich aber noch nie im Laden gesehen hatte.« Er sei »super lecker« gewesen. Genauso wie der frische Spinat, der sogar ihren anfangs noch skeptischen Mann überzeugt habe. Woher die anfängliche Skepsis kam? Der Preis. »Es ist ja schon einen Ticken teurer. Aber ich mag es, zu wissen, wo mein Gemüse herkommt.« Zudem gebe es immer wieder Mails, in denen auch die Probleme des Bauernpaares thematisiert werden. »Im Supermarkt sieht man nur das makellose Gemüse, ohne zu wissen, was damit verbunden ist.«

Fair, nachhaltig, global
Und so steigen die Mitgliederzahlen der Solawi42 stetig an. Momentan gebe es Bemühungen ein zweites Depot in einem anderen Stadtteil aufzumachen, sagt Alexis. »Das würde unsere Kapazitäten deutlich erweitern.« Bei fast allen Solawis in Deutschland gebe es Wartelisten, »auch wir haben eine Interessentenliste für das nächste Erntejahr.« Ob es dann neben dem Olivenöl und dem indischen Tee noch weitere ausländische Produkte geben wird, bleibt abzuwarten. »Die Bauern und Bäuerinnen aus Griechenland haben uns auch Oregano angeboten, aber da haben wir abgelehnt.« Kräuter könne man auch problemlos in Deutschland anbauen.
Andere Ideen wurden hingegen bereits diskutiert, wie den Einkauf vom fair und nachhaltig produzierten Teikei-Kaffee, der mit dem Segelschiff aus Mexiko importiert wird. »Aber bislang hatte einfach noch niemand Zeit, sich darum zu kümmern«, sagt Alexis. Auch Alternativen zum griechischen Olivenöl wären denkbar. »Vielleicht entdeckt jemand eine lokale Bio-Sonnenblumenölproduktion, dann könnten wir das Olivenöl abschaffen.« Aber das sei noch Zukunftsmusik. Es gebe nur sehr wenige Bio-Produktionsorte in der Umgebung. »Die Lage ist desaströs«, sagt Alexis, »es gibt ein paar Leuchtturmprojekte, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns.« Und so werden sich schon bald die nächsten Paletten mit solidarischem Olivenöl auf ihren Weg von Griechenland nach Frankfurt machen. © Fotos: Solawi42 und Kristin Kasten
→ Kristin Kasten
Dieser Beitrag erschien in Ausgabe 89 — Winter 2020